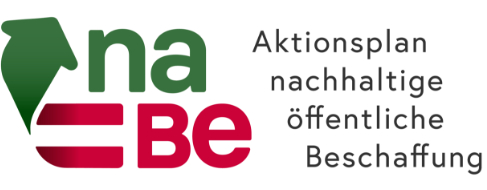Zusammenfassung
Eine Klimabilanzierung misst die Treibhausgasemissionen, die durch eine bestimmte Organisation, ein Produkt oder eine Dienstleistung verursacht werden. Fundierte Daten helfen dabei, den CO2-Fußabdruck eines Produkts oder Projekts zu verstehen. Was dies für die Beschaffung an Herausforderung mit sich bringt, erfahren Sie hier.
Klimabilanzierung und Beschaffung
Eine Klimabilanzierung misst die Treibhausgasemissionen von bestimmten Aktivitäten. Das funktioniert auch für das Herstellen von Produkten und Dienstleistungen. Doch das ist alles andere als einfach. Welche Emissionen sind zurechenbar und welche nicht? Einige Protokolle, Normen und Standards schlagen Regeln vor, wie das zu tun ist. Die Grundidee: Erst fundierte Daten aus allen Stadien des Lebenszyklus helfen dabei, den CO2-Fußabdruck einer Aktivität genau zu verstehen. Nur so können sinnvolle Maßnahmen entwickelt werden, um den CO2-Fußabruck zu verringern. Das Ganze für die Beschaffung nutzbar zu machen, bringt weitere Herausforderungen mit sich. Hier finden sich erste Ansätze für Umweltbewertungen im Vergabewesen!
Laut einer Studie des WIFO verursacht die öffentliche Beschaffung in Österreich jährlich 8 % der nationalen Emissionen (5,6 Mio. Tonnen) und 19 Mio. Tonnen weltweit.
Die Emissionen entstehen zu einem großen Teil indirekt entlang der Lieferketten, nicht nur bei den direkt beauftragten Unternehmen. Nur 32 % der Emissionen entstehen direkt bei den Auftragnehmern. Rund zwei Drittel der Emissionen entstehen bei Bauleistungen sowie bei der Sachgüterproduktion. Daher ist die Analyse ganzer Wertschöpfungsketten zentral für das Verständnis der Emissionswirkungen und eine produkt- oder zumindest eine sektorspezifische Klimabilanzierung sinnvoll. Der Klimafußabdruck ist auch nicht der einzige relevante Umweltaspekt der öffentlichen Beschaffung.
- WIFO (2023): Die Rolle des öffentlichen Vergabewesens für eine klimaneutrale Produktions- und Lebensweise
- WU (2024): Eine Analyse des weltweiten Materialverbrauchs und der Treibhausgasemissionen der öffentlichen Nachfrage Österreichs – WU Wirtschaftsuniversität Wien
Vereinfacht ausgedrückt lassen sich hier drei methodische Herangehensweisen identifizieren. Klimadaten können im Zuge der Ausschreibungsplanung, in Vergabeverfahren oder auch nach dem Zuschlag nützlich sein. Dies ist mit rechtlichen und methodischen Herausforderungen verbunden. Doch erste Good-Practices zeigen bereits Wege auf, wie Umweltbewertungsmethoden nutzbar gemacht werden könnten.
- UBA et al. (2021): Study on the implementation of life cycle assessment and environmental footprint methods in the context of public procurement – Publications Office of the EU
- Steubing (2022): How do carbon footprints from LCA and EEIOA databases compare? A comparison of ecoinvent and EXIOBASE – Steubing – 2022 – Journal of Industrial Ecology
Aufwände und Nutzen variieren je nach beschaffender Stelle und Anwendungsfall stark. Zudem handelt es sich um einen dynamischen Arbeitsbereich, der auch in den kommenden Jahren viele Veränderungen erfahren wird. Informationsbedarfe und -gebote werden weiter zunehmen (vgl. Digitaler Produkt Pass, EU-ETS II etc.). Die naBe-Plattform vernetzt daher Akteurinnen und Akteure, sowie Stakeholder, um dieses komplexe Feld gemeinsam weiter zu bearbeiten.
Weiterführende Links:
Methodologie
Product Standard | GHG Protocol
Product Carbon Footprint nach ISO 14067
EU-Kommission – Environmental Footprint Methoden
BSI – PAS 2050 Spezifikation
Werkzeuge
ÖBB – TCO CO2 Tool
DUBA – Arbeitshilfe zur Berechnung von LCC inkl. CO2-Kosten
Ecoinvent – LCI-Data Base
Exiobase – MR-EEIO-Data Base
Giljum et al. – A Comparison of Exiobase, Eora und ICIO
Ergebnisse
UBA – Die Ökobilanz von PKW.pdf
UBA – Emissionsfaktoren für Verkehrsmittel
UBA – Treibhausgasemissionen von Strom.pdf
DUBA – Umweltwirkungen des Cloud Computing
Header und Beitragsbilder: © Canva