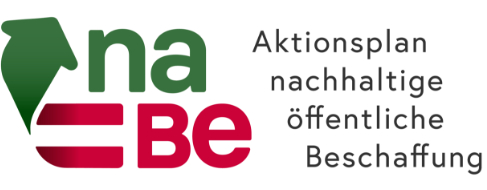Zusammenfassung
Nachhaltige öffentliche Beschaffung braucht verlässliche Daten – doch wie lassen sich Umweltauswirkungen messen? Der Artikel beschreibt den Status des internationalen GPP-Monitorings.
Green Public Procurement-Monitoring: Ein Blick auf Europa
Gute Daten sind entscheidend – nicht zuletzt für eine nachhaltigere öffentliche Beschaffung! Sie helfen nicht nur, ihre konkreten Auswirkungen auf die Umwelt sichtbar zu machen, sondern diese auch aktiv zu steuern. Den ökologischen Fußabdruck der Beschaffungen einer Organisation systematisch zu erfassen, schafft Transparenz und folglich auch mehr Vertrauen. Doch noch stehen öffentliche Auftraggeber europaweit vor vielen methodischen Herausforderungen bei der Datensammlung und -erfassung: Nationale Vergabestrukturen unterscheiden sich, digitale Plattformen und Systeme sind oftmals Insellösungen, ein durchgängiger digitaler roter Faden ist noch nicht Realität: Aussagekräftige Daten sind häufig auf viele Archive verteilt oder noch nicht durchgehend in der gewünschten Qualität vorhanden. Standards konsolidieren sich Schritt für Schritt. Neue Monitoring-Systeme verknüpfen Bestände oder erschließen neue Informationsquellen. Das Motto lautet „Digitalisierung statt bloßer EDV!“ Es folgt ein Blick auf die aktuellen Entwicklungen.
Ein effektives Monitoring ist unerlässlich geworden, um Green Public Procurement (GPP) sinnvoll umzusetzen. Durch die Messung des Umweltfußabdrucks von beschafften Produkten und Dienstleistungen können Organisationen nicht nur wirtschaftlich nachhaltiger agieren. Sie haben auch die Möglichkeit, ihre Umweltbilanz kontinuierlich zu verbessern, indem sie auf umweltfreundlichere Einkaufsportfolios setzen. Ein auf Umweltaspekte erweitertes Monitoring liefert also unverzichtbare Daten für das Management und ermöglicht fundiertere Entscheidungen. Genau wie auf nationaler Ebene (z.B. Umweltbilanzen, CO2-Inventare) ist Monitoring auch auf Ebene von Organisationen oder sogar bei einzelnen Prozessen möglich.
Ein Blick auf die internationale Beschaffungslandschaft macht schnell deutlich, dass sich zwar die übergeordneten Ziele überall gleichen, die Ansätze von EU-Mitgliedsstaaten aber vielfältig sind. Die EU-Vergaberichtlinien dienen hier als Leitplanken, nationale Institutionen und Einrichtungen variieren aber weiterhin.
Während in sämtlichen EU-Mitgliedsstaaten auch traditionelle Methoden nach wie vor eine Rolle spielen, hat sich in Österreich ein fortschrittliches elektronisches Beschaffungssystem (E-Procurement) etabliert. Mittendrin bündelt eine zentrale Beschaffungsstelle, die Bundesbeschaffung GmbH (BBG), die Bedarfe öffentlicher Einrichtungen in ganz Österreich und schreibt diese aus. Im e-Shop der BBG stehen den öffentlichen Auftraggebern mehr als drei Millionen Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung.
Die in der BBG angesiedelte Plattform für nachhaltige öffentliche Beschaffung (naBe-Plattform) unterstützt und begleitet das Umsetzen des österreichischen Aktionsplans für nachhaltige öffentliche Beschaffung.
Monitoring ist künftig ein unverzichtbares Instrument. Derzeit sind in diesem Zusammenhang Evaluierungen auf mehreren Ebenen vorgesehen. Im Austausch mit internationalen Vorreitern wie Dänemark, Norwegen und der Schweiz baut die naBe-Plattform ihr Fachwissen kontinuierlich aus. Langfristiges Ziel ist die automationsunterstützte Auswertung von Ausschreibungsunterlagen und Einkaufsstatistiken – und inwieweit diese jeweils den Vorgaben des naBe-Aktionsplans entsprechen. Letzteres stellt im Lichte von mehr als 180 Kernkriterien für 16 Produktgruppen eine Herausforderung dar. Der Fokus wird auf die wichtigsten Kennzahlen zu legen sein.
Die Forschungs- und Entwicklungsinitiativen internationaler Vorreiter basieren im Kern auf folgenden Ansätzen:
- Integration von E-Procurement-Systemen via Schnittstellen für einen digitalen roten Faden
- Zusammenführung von Beschaffungs- und Umweltauswirkungsdaten
- Datenanalysen mithilfe von statistischen Methoden oder von Machine-Learning-Verfahren
In vielen EU-Mitgliedsstaaten dienen veröffentlichte Ausschreibungsunterlagen (vgl. TED-Portal) und/oder Einkaufsdaten als Stammdaten. Folglich werden tausende Seiten von Unterlagen und Millionen von Rechnungspositionen jährlich zum Gegenstand des GPP-Monitorings. Diese enthalten nicht alle Informationen, die für eine Bewertung von Nachhaltigkeit benötigt werden. Es ist vielmehr ein Ausweiten auf umweltrelevante Daten aus weiteren integren Quellen angezeigt. Angesichts solcher Datenmengen stellen auch manuelles Prüfen und Auswerten auf Sicht keine tragfähigen Lösungen mehr dar. Komplexe Warenwirtschaftssysteme sind bei so vielen beteiligten Stellen und Zuständigen in organisatorisch voneinander getrennten Bereichen eine immense Herausforderung. Ebenso wie die Zusammenarbeit mit Tausenden von unterschiedlichen Auftragnehmern.
Gleichzeitig schreiten Entwicklungen in Europa und weltweit kontinuierlich voran. Neue Richtlinien, Regeln und Standards – etwa die Green Claims Richtlinie oder die neuen europäischen Standards für Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESRS) – erhöhen u. a. den Bedarf an hochwertigen Umweltdaten primär auf der Angebots-, aber auch auf der Nachfrageseite des Beschaffungsmarkts weiter. So stellen Datenservices wie z. B. Ökobilanzdatenbanken mehr und mehr Daten in immer höherer Qualität zur Verfügung. Dazu treiben Umweltmanagementsysteme wie EMAS oder ISO 14001 die Konsolidierung der Datenlage im Innenleben zertifizierter Organisationen voran. Die Ökodesign-Verordnung der EU (ESPR) sowie die EU-Lieferketten-Richtlinie (CSDDD) werden Organisationen, die Produkte auf dem europäischen Binnenmarkt in Verkehr bringen, noch mehr in die Pflicht nehmen.
Zur Kennzeichnung umweltfreundlicher Produkte sind bislang Typ-I-Umweltzeichen wie das österreichische Umweltzeichen, der Blaue Engel oder das EU-Ecolabel wichtige Instrumente. Auch der naBe-Aktionsplan setzt stark auf Gütesiegel oder gleichwertige Nachweise. Zertifizierungen sind jedoch noch oft freiwilliger Natur, regionalen Charakters oder nicht auf allen Märkten gleichermaßen etabliert. In technischer Hinsicht stehen nicht immer offene Datenbanken zur Verfügung, die ökologische Informationen zu ausgezeichneten Produkten preisgeben (vgl. EPREL-Label, EU-Ecolabel, TCO-Productfinder, Öko-Rein-Datenbank, Top-Produkte etc.). Um die Transparenz entlang des gesamten Lebenszyklus eines Produkts weiter zu verbessern, soll ab 2027 ein Digitaler Produktpass (DPP) für alle in der EU tätigen Unternehmen schrittweise zur Pflicht werden.
Fazit: Ein robustes Monitoring ist für eine nachhaltige öffentliche Beschaffung auf lange Sicht zentral. Europaweit sind Datenlage und Auswertungsverfahren noch nicht ganz auf der Zielgeraden. Die kommenden Jahre werden zeigen, welche Ansätze sich durchsetzen und für die nachhaltige Beschaffung in Österreich maßzuschneidern sind.
Header & Beitragsbild: © Adobe Stock